
Wie soll er sein, der Neue?
- Text: Helene AecherliIllustrationen: Lisa Hartung
annabelle-Redaktorin Helene Aecherli findet, die Suche nach einem neuen Auto ist fast noch anspruchsvoller als die Suche nach einem Mann.
Es gab in meinem Leben bisher zwei benzinbetriebenen Begleiter: ein rotes Puch-Maxi-Töffli und einen armeegrünen Datsun aus dem Jahr 1978. Das Puch Maxi hatte ich mir mit 14 hart erkämpft und vom Mund abgespart, bedeutete es doch die Emanzipation von der elterlichen Drohung «Wir holen dich dann um zehn Uhr vom Klassenfest ab, gell». Den Datsun kaufte ich mir knapp neun Jahre später für 1200 Dollar während meiner Studienzeit in Kalifornien. Ich erstand ihn von einem Occasionswagenhändler in San Bernardino, fuhr ihn aber ungeschickterweise nur wenige Monate später zu Halbschrott, weil ich ein Rotlicht übersah und einen Sportwagen touchierte. In der Folge quälte ich meinen geschundenen Wagen so lange über die Highways, bis er eines Tages wegen eines Lecks im Öltank mitten auf der Überholspur zusammenbrach. Seither ist das Generalabonnement der SBB mein Billett zur Mobilität.
In letzter Zeit erwische ich mich jedoch immer häufiger dabei, dass ich damit liebäugle, das GA durch die Wiederbelebung meines Führerscheins zu ergänzen. Mit anderen Worten: Im Alter von 43 Jahren erwäge ich, mir ein Auto zu kaufen, und zwar ein «richtiges»; nicht für den Stadtverkehr, dafür habe ich weder Zeit noch Nerven, sondern für berufliche Überlandfahrten, Reisen in die Toscana und, ich gebe es zu: für epische Ikea-Trips. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Der Entschluss war schneller gefasst als die ersten Schritte getan. Denn für Novizinnen entpuppt sich die Autobranche als schillernder Jahrmarkt, auf dem die Hersteller wie Kasperlifiguren aus ihren Boxen federn, um ihre vierrädrigen Preziosen in all ihren Formen und Vorzügen anzubieten. Das ist für eine erste Kartlegung der eigenen Vorlieben sehr anspruchsvoll, zumal ich von meinem zukünftigen Gefährt viel verlange: Als Anhängerin der künftigen 2000-Watt-Gesellschaft würde ich nur einen Wagen fahren wollen, der weniger als sieben Liter Treibstoff und nicht sehr viel mehr als 130 Gramm CO2 pro 100 Kilometer verbraucht. Er muss sicher in der Kurve liegen, stabil sein und zuverlässig, nahtlos am Berg anfahren (seit ich den Skoda meines Ex-Freunds um ein Haar in einen Porsche hinter uns rollen liess, weil ich vor lauter Stress in den dritten statt in den ersten Gang schaltete, habe ich ein Trauma) und bequem Freunde, Koffer und Billy-Regale transportieren können. Darüber hinaus soll er ein angenehmes Raumgefühl bieten (aber bitte ohne beleuchtete Make-up-Spiegel und Sitzheizung, im Jargon heterosexueller Männer auch liebevoll «Muschitoaster» genannt), schnittig aussehen und last but not least auch finanzierbar sein.
 «Ich weiss, meine Ansprüche sind hoch», sagte ich den Autohändlern jeweils in vorauseilender Demut. «Kein Problem, meine Dame», konterten sie in wohl einstudiertem Refrain. «Wir haben da den perfekten Wagen für Sie.»
«Ich weiss, meine Ansprüche sind hoch», sagte ich den Autohändlern jeweils in vorauseilender Demut. «Kein Problem, meine Dame», konterten sie in wohl einstudiertem Refrain. «Wir haben da den perfekten Wagen für Sie.»
Zum Auftakt meiner Auto-Evaluation folgte ich einem Hinweis von kundigen Freunden und inspizierte den neuen Twingo Gordini R. S. Der sei klein, schnell und frech, meinten sie, und würde deshalb wunderbar zu mir passen (vielen Dank!). Das empfand ich auf den ersten Blick dann aber genauso: ein kompaktes, muskulöses Auto, Malta-Blau Metallic mit weissen Doppelstreifen, eine Mischung aus Boxhandschuh und Putschauto, benannt nach dem französischen Renn-Ingenieur Amédée Gordini. Ich malte mir aus, wie ich mit johlenden Freundinnen auf den Mitfahrersitzen zum pulsierenden Sound der Pointer Sisters Richtung Rom preschen und dort jegliche Konkurrenz uralt aussehen lassen würde, und ich fühlte bereits erste Kaufwärme in mir aufsteigen, als ich mir seinen CO2-Ausstoss näher ansah: 165 Gramm pro 100 Kilometer, damit gehört er in die Energieeffizienzklasse D (A ist die höchste, G die tiefste). Das sei bei Sportwagen üblich, sagte der Händler, je kraftvoller ein Auto, desto höher Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen. Die sind natürlich auch vom Fahrstil und anderen technischen Faktoren abhängig. Etwa davon, schreibt das Magazin des Verkehrs-Clubs der Schweiz, ob Scheinwerfer oder Klimaanlage eingeschaltet sind oder ob das Auto durch breitere Pneus, Navigationsgerät, Elektromotoren für Sitze oder Schiebedach mehr Gewicht auf die Waage bringt. Zudem hat eine Studie des Ökoglobe-Instituts der Universität Duisburg-Essen nachgewiesen, dass die angegebenen Verbrauchswerte häufig niedriger sind, als sie es tatsächlich sein werden. Bei Testfahrten bleiben die elektrischen Geräte oft ausgeschaltet, darüber hinaus werden nur die Modelle mit der leichtesten Grundausstattung geprüft.
Als Nächstes gönnte ich mir einige Minuten als potenzielle Eigentümerin eines Chrysler. Ich tat dies in der stillen Hoffnung, dass die Amerikaner endlich effizientere Motoren eingebaut bekommen hatten, zudem war ich getrieben von süsser Melancholie: Vor Jahren hatte ich bei einem Abstecher ins Nappa Valley ein gemietetes goldfarbenes Chrysler-Cabriolet gefahren und weingefüllte Pralinés gegessen, während der laue Wind mein Gesicht liebkoste. Seither hatte ich von einem Chrysler geträumt, und so fühlte ich mich beim Anblick des neuen Sebring Cabrio Limited merkwürdig gerührt, seine Schönheit verursachte mir sogar leichte Schwindelgefühle. Umso mehr betrübte es mich dann aber, als ich realisierte, dass ich einen wahren Schluckspecht vor mir hatte: Der 6-Gang-Automat benötigt 10.5 Liter Treibstoff auf 100 Kilometer, was ihn in die Effizienzklasse F katapultiert. Ich schlich mich mit hängendem Kopf von dannen.
Einer meiner liebsten Freunde, ein leidenschaftlicher Autofahrer, machte mich zur Aufmunterung auf den VW Eos aufmerksam. «Wäre ich zehn Jahre jünger», sagte er, «und hätte weder Familie noch Hund, ich würde mir den auf der Stelle kaufen.» – « Also passt das Teil genau zu mir», frohlockte ich und war dementsprechend entzückt, als ich im Autoshop um das Prachtexemplar in Candyweiss tigerte. Ein Cabriolet-Coupé mit Glasschiebedach, 1.4-Liter-Motor, mit Sechsgangschaltgetriebe, 122 PS, Energieeffizienzklasse A, mein Fuss lechzte nach dem Gaspedal.
 Ich war schon daran, eine Testfahrt zu vereinbaren, als ich kontrollierte, ob diese Preziose denn auch Ikea-kampftauglich wäre. Ein Blick in den Kofferraum verflüchtigte jegliche Ambitionen: In diesem engen Graben (okay, der Platz gehört dem zusammengelegten Dach) hätten vielleicht Rucksack und Wanderschuhe Platz, aber kaum ein paar ernsthaft gefüllte Taschen, geschweige denn die Koffer von vier Mitreisenden. «Der Eos ist eher ein Zweitauto», sagte der Händler eifrig. «Ein alltagstaugliches Spassauto», doppelte ich mit Kennermiene nach. Der Händler grinste. Ich grinste zurück. 42 250 Franken für ein Zweitauto? Sehe ich denn aus wie die gelangweilte Ehefrau eines Bankdirektors? Selbst wenn ich dieses Geld hätte, würde ich es lieber in meine Vorsorge investieren.
Ich war schon daran, eine Testfahrt zu vereinbaren, als ich kontrollierte, ob diese Preziose denn auch Ikea-kampftauglich wäre. Ein Blick in den Kofferraum verflüchtigte jegliche Ambitionen: In diesem engen Graben (okay, der Platz gehört dem zusammengelegten Dach) hätten vielleicht Rucksack und Wanderschuhe Platz, aber kaum ein paar ernsthaft gefüllte Taschen, geschweige denn die Koffer von vier Mitreisenden. «Der Eos ist eher ein Zweitauto», sagte der Händler eifrig. «Ein alltagstaugliches Spassauto», doppelte ich mit Kennermiene nach. Der Händler grinste. Ich grinste zurück. 42 250 Franken für ein Zweitauto? Sehe ich denn aus wie die gelangweilte Ehefrau eines Bankdirektors? Selbst wenn ich dieses Geld hätte, würde ich es lieber in meine Vorsorge investieren.
Je länger meine Odyssee dauerte, desto zwiespältiger erschien mir die Suche nach meinem vierrädrigen Alter Ego. Einerseits war sie euphorisierend, andererseits fragte ich mich jedes Mal, wenn ich als Fussgängerin am Zebrastreifen heftig mit den Händen wedelte, um Automobilisten dazu zu bewegen, abzubremsen, und dafür den Stinkfinger gezeigt bekam: Will ich überhaupt in den Club der Motorisierten? Will ich mich als Autofahrerin den Gefahren der Strasse aussetzen, Staus erdulden, mich von Rasern bedrängen lassen, Bussen riskieren, nach Parkplätzen suchen? Ich fahre gern, aber muss ich ein Auto gleich besitzen? Wäre ich nicht ebenso glücklich, wenn ich mich bei Mobility einkaufen oder bei Bedarf einfach ein tolles Auto mieten würde?
In diesem Zustand der inneren Zerrissenheit ging ich zu einem BMW-Händler, Abteilung Neuwagen. Der Grund dafür war simpel: Am Vortag hatte mir eine Kollegin aus ihrem BMW-3er-Coupé zugewinkt und dabei so entrückt ausgesehen («Hed dä Pfupff!»), dass ich mir dachte: So einen will ich mir zumindest mal ansehen. Ich erblickte ihn sofort: schwarz, stromlinienförmig, sportlich-elegant (leider nur zwei Türen, aber egal), die Rücksitze leicht herunterklappbar, wodurch ein Billy-Regal und zwei Koffer locker Platz hätten, viel Stauraum in den Türverkleidungen, Crash-aktive Kopfstützen, Energieeffizienzklasse B mit einem Dieselmotor (plus wartungsfreiem Russpartikelfilter), der Preis: rund 70 000 Franken. Ich schluckte, konnte es aber nicht lassen, mich hinters Steuerrad zu setzen. Er passte zu mir wie der Schuh an Aschenputtels Fuss. «Der ist wie für Sie gemacht», keuchte der Händler aufgeregt, weil er mit dem Instinkt eines orientalischen Teppichverkäufers meinen Schmelzpunkt witterte. «Noch besser fände ich für Sie aber den 3er in Spacegrau, wäre echt verschärft …» – «Aber 70 000 …» – «Keine Sorge, wir bringen auch für 60 000 was Schönes her. Wie lange wollen Sie ihn denn fahren?» – «Bitte?» – «Die durchschnittliche Dauer des Autobesitzes beträgt heute sechs Jahre. So, wie ich Sie einschätze …» – «Ja, wie denn?» – «Sie sind modisch gestylt. Sie wollen doch mit dem Trend gehen und nach drei Jahren was Neues haben, oder?» – «Nicht unbedingt, ich bin eigentlich ziemlich treu …» – «Ah, sehr erfrischend in der heutigen Zeit. Kommen Sie, ich mache Ihnen mal einige Leasingofferten. Leasing ist das Beste. Sie haben kein gebundenes Geld, keine Sorgen und können das Auto bei Vertragsende einfach wieder zurückgeben.»
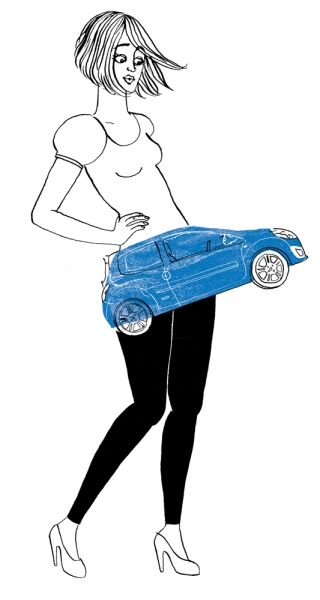 Leasing, das ist das Zauberwort der Branche. Es impliziert die Demokratisierung des Autobesitzes, jedermann kann das Auto fahren, das er will, auch wenn er es sich nicht leisten dürfte. Mittlerweile sind Leasinverträge so dehnbar wie Kaugummi, hatte mir ein Autohändler gesagt. Sie können fast exakt auf die Bedürfnisse des Kunden massgeschneidert werden, haben, je nach Marke und Händler, unterschiedliche Zinssätze und beinhalten Wartung, Garantie und sogar eine Versicherung, die die Leasingraten teilweise oder ganz übernimmt, falls man sie auf Grund von Arbeitslosigkeit oder wegen eines Unfalls nicht mehr bezahlen kann. Firmen können die Leasinggebühren als Geschäftsaufwand verrechnen (Private nur die Schuldzinsen des Autokaufs vom steuerbaren Einkommen abziehen), was oftmals mit ein Grund dafür ist, warum Besitzer von KMU plötzlich im brandneuen Jaguar vorfahren. Vermittelt der Autoverkäufer einen Leasingvertrag, bekommt er von der Bank, mit der sein Unternehmen zusammenarbeitet und die dann ab sofort Eigentümerin des Neuwagens ist, eine Provision. Mehr als einige Hundert Franken liegen dabei jedoch kaum mehr drin, verriet ein Händler, in den Neunzigerjahren habe man damit noch mehr Geld verdient. Für den Kunden gilt: Wer ein Auto least, bezahlt ein Mehr von rund 8 Prozent des Kaufpreises. Mit anderen Worten: Unter dem Strich ist Kaufen günstiger.
Leasing, das ist das Zauberwort der Branche. Es impliziert die Demokratisierung des Autobesitzes, jedermann kann das Auto fahren, das er will, auch wenn er es sich nicht leisten dürfte. Mittlerweile sind Leasinverträge so dehnbar wie Kaugummi, hatte mir ein Autohändler gesagt. Sie können fast exakt auf die Bedürfnisse des Kunden massgeschneidert werden, haben, je nach Marke und Händler, unterschiedliche Zinssätze und beinhalten Wartung, Garantie und sogar eine Versicherung, die die Leasingraten teilweise oder ganz übernimmt, falls man sie auf Grund von Arbeitslosigkeit oder wegen eines Unfalls nicht mehr bezahlen kann. Firmen können die Leasinggebühren als Geschäftsaufwand verrechnen (Private nur die Schuldzinsen des Autokaufs vom steuerbaren Einkommen abziehen), was oftmals mit ein Grund dafür ist, warum Besitzer von KMU plötzlich im brandneuen Jaguar vorfahren. Vermittelt der Autoverkäufer einen Leasingvertrag, bekommt er von der Bank, mit der sein Unternehmen zusammenarbeitet und die dann ab sofort Eigentümerin des Neuwagens ist, eine Provision. Mehr als einige Hundert Franken liegen dabei jedoch kaum mehr drin, verriet ein Händler, in den Neunzigerjahren habe man damit noch mehr Geld verdient. Für den Kunden gilt: Wer ein Auto least, bezahlt ein Mehr von rund 8 Prozent des Kaufpreises. Mit anderen Worten: Unter dem Strich ist Kaufen günstiger.
Bevor ich mich dazu hinreissen liess, einen Finanzierungsplan für mein BMW-3er-Coupé zu erstellen, begutachtete ich einen Honda Jazz Exclusive. Eine Kollegin hatte mich dazu gebracht, mein Augenmerk auf diese Marke zu richten. Sie hatte sich ihren Honda CRV vor zehn Jahren mit Hilfe eines privaten Darlehens erstanden und würde ihn nicht mehr hergeben. Er sei zuverlässig und robust, sagt sie, und habe hinten Platz für Hund und Mountainbikes. Nun, der CRV war mir zu wuchtig, die verwandte Limousine Insight Hybrid zu familiär (obwohl mir der Benzin-Elektro-Antrieb sehr gefiel), aber den Jazz schloss ich sofort ins Herz. Denn so, wie er vor mir stand, erinnerte er mich an die sportliche Keckheit tibetischer Ponys, die so trittsicher sind, dass sie nachts glitschige Treppenstufen hinaufgaloppieren können. Zudem hat der Jazz verstellbare Rücksitze, wodurch Platz für 27 Bananenschachteln (kein Witz) entsteht, Vorhangairbags, ein Panorama-Glasdach, ein 6-Stufen-i-Shift-Schaltgetriebe mit Wippschalterbedienung am Steuerrad zur Treibstoffeinsparung (ich wusste nicht einmal, dass es das gibt), einen Anfahr-Assistenten in Steigungen (perfekt zur Trauma-Überwindung) und gehört mit einem Verbrauch von 5.4 Litern zur A-Klasse der Energieeffizienten. Der Preis: 26 400 Franken.
Eigentlich hätte ich jetzt mit der Suche aufhören können, aber ich wusste, der Jazz war ein Etappenziel, der Jahrmarkt der Automobilindustrie würde meine Neugierde weiter anstacheln. Eben haben zwei Kolleginnen unabhängig voneinander von ihren Alfa Romeos geschwärmt (ja, ja, ich weiss, der Sexappeal der Italianità). Und ein Freund erzählte mir aufgeregt vom Honda CR-Z, einem Sportcoupé-Hybrid, der im Juni auf den Markt kommt. Diese Gefährte will ich mir unbedingt noch ansehen. Aber dann werde ich mich entscheiden. Ganz sicher.






