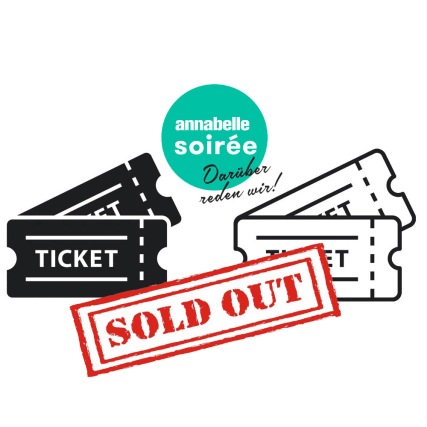Karriere, Kind, Kollaps
- Text: Nadine Jürgensen
- Illustration: Shout/Alessandro Gottardo
Frauen und Männer sind gleichberechtigt – bis sie Kinder haben. Dann steht der Mythos von Mutterschaft, Job und Hapiness auf dem Prüfstand. Unsere Autorin fordert eine schonungslos ehrliche Debatte über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Ehrlich gesagt bin ich ganz schön auf die Welt gekommen, als ich Mutter wurde. Bis dahin war ich überzeugt gewesen, dass Frauen beruflich genauso wie Männer ihre Ziele erreichen können – wenn sie nur wollen. Ich war gerade dreissig, hatte mein Anwaltspatent seit ein paar Jahren in der Tasche und arbeitete auf der Inlandredaktion einer grossen Schweizer Tageszeitung. Ich liebte den Job. Und jetzt ein Kind? Das sollte heutzutage doch kein Problem mehr sein.
Vielleicht wollte ich es gar nicht wissen. All die Kompromisse, die folgen würden. Die belastenden Emotionen, das permanente schlechte Gewissen. Weder möchte ich mich beklagen, noch andere Frauen entmutigen. Doch dem Mythos, dass sich für Frauen eine Familie mit einer erfolgreichen, bezahlten Beschäftigung vereinbaren lässt, muss mit mehr Ehrlichkeit begegnet werden. Ich sage nicht, dass es nicht geht. Aber warum sprechen wir nicht über diese kleinen Momente voll grosser Verzweiflung. Die Erschöpfung, die sich morgens unter den Augen spiegelt. Die Wut und die Trauer darüber, immer zu meinen, nicht zu genügen. Die Kraft, die es braucht, um weiterzumachen.
Keine Frau weiss, was für eine Mutter sie sein wird. Ich kenne Frauen, die sind drei Monate nach der Geburt von Zwillingen, allerdings ohne zu stillen, wieder zu hundert Prozent in ihren alten Job eingestiegen. Andere könnten sich nie im Leben bereits dann von ihren Kindern trennen. Ich war hin- und hergerissen. Zwar wollte ich weiterhin Leitartikel schreiben, interessante Persönlichkeiten interviewen und den Dingen auf den Grund gehen. Gleichzeitig war da dieser kleine Mensch, der so unglaublich duftete und am liebsten bei mir oder meinem Mann auf der Brust schlief. Diese runden Bäckchen und Zopfteigärmchen, die sich nach mir ausstreckten, kaum war ich in der Nähe.
Der sogenannte Mutterschaftsurlaub in seiner jetzigen Form ist ein gutschweizerischer Kompromiss. Kaum dafür geeignet, die Belastung zu tragen, welche auf eine Kleinfamilie nach einer Geburt zukommt. Vielleicht würde der 14-wöchige Mutterschaftsurlaub in einer optimalen Welt reichen. Bei einer problemlosen Geburt, die keine Gräben in die Psyche und den Körper der Gebärenden schlägt. Wenn das Kind gesund ist, die Eltern nah genug beim Arbeitsort wohnen und auf eine ideale Säuglingsbetreuung zählen können. Aber, wo gibt es sie schon, die optimale Welt?
Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, mindestens sechs Monate voll zu stillen und danach zwei Jahre nach Bedarf. Kein Wunder, verlängern die meisten Frauen, die es sich irgendwie leisten können, ihre Baby- pause mit einem unbezahlten Urlaub auf eigene Kosten. Stillbeziehung und eine Vollzeitstelle? Selbst Mütter, denen es gelingt, Muttermilch abzupumpen, kennen die Schwierigkeiten. Seit 2014 ist zwar gesetzlich ein zur Verfügung gestellter Raum am Arbeitsplatz vorgeschrieben und die entsprechende Zeit muss gewährt werden, doch es bedeutet, morgens das Kühltäschchen mit Pumpe und Behältern zum Arbeitsplatz zu tragen und dort den Stillrhythmus fortzusetzen. Dazu gehört, dass die Milch mitten in einer Sitzung einschiesst oder gar nicht fliessen will, wie lang man sich die Babybilder am Handy auch anschaut. Es bedeutet Pausen; die fehlende Arbeits- zeit wird abends vor dem leuchtenden Laptop neben dem (hoffentlich!) schlafenden Baby nachgeholt. Mich plagten nach der Geburt eine Brustentzündung, die Trauer über eine traumatisch empfundene Geburt sowie ein immer schreiendes Baby, und nach drei Monaten war ich dank einer einfühlsamen Mütterberaterin gerade so weit zu realisieren, dass ich mir psychologische Hilfe suchen musste, was ich auch tat. Dennoch startete ich sechs Monate nach der Geburt zu sechzig Prozent wieder in meinem alten Job. Die Milch allerdings, die war schnell weg. Obwohl ich im ersten halben Jahr nach dem Wiedereinstieg in der glücklichen Lage war, dass meine Mutter zwei Tage und meine Schwiegermutter an einem Tag bei uns zuhause für unsere Tochter sorgten.
So schwirrte ich anfangs am Morgen sorglos zur Arbeit. Der Einstieg in der Krippe verlief zuerst auch problemlos, doch als die engste Bezugsperson kündigte, begann der Spiessrutenlauf. Wollte ich meine Tochter in der Krippe abgeben, brüllte sie herzzerreissend und klammerte sich an mir fest, wenn ich gehen musste. Die vielen Praktikanten, die wechselnden Bezugspersonen – das war zu viel für sie. Bevor ich morgens zur Planungssitzung erschien, wischte ich mir die Tränen ab. Natürlich hatte ich da die Zeitungen noch nicht gelesen und hoffte inständig, der Tag würde es zulassen, dass ich rechtzeitig aus dem Büro komme, um die Kleine um 18 Uhr abzuholen.
Mein Mann arbeitete damals in einer anderen Stadt und war viel im Ausland. Oft waren wir auf uns allein gestellt, meine Tochter und ich. Ich beschloss, uns eine Kinderfrau zu suchen. Meine Tochter war zwei Jahre alt, als dies gelang. Nachdem auch sie gekündigt hatte, ergab sich zum Glück eine neue Betreuungsmöglichkeit bei einer Tagesmutter. Sie wurde zu einer wichtigen Stütze für uns. Dennoch merkte ich, dass meine Arbeitsumgebung mit den anspruchsvollen Dossiers und die Bedürfnisse meiner Familie und meiner selbst immer weniger zusammenpassten.
Lang habe ich versucht, bei der Geschwindigkeit, die das News-Business mit sich bringt, mitzuhalten. Doch während meine (fast allesamt) kinderlosen, männlichen Kollegen abends noch den Feinschliff an ihren Artikeln erledigten, hetzte ich los. Manchmal gab ich den Text ab, manchmal loggte ich mich nachts wieder ins System ein und arbeitete weiter. Feierabendbier mit Kollegen? Fehlanzeige. Während der Arbeitszeit war ich unentspannt, wenn die Kollegen in den Gängen schwatzten, vergrub ich mich gleich wieder hinter dem Bildschirm, immer mit der Angst, nicht fertig zu werden. Immerhin war ich effizient, schrieb ungefähr gleich viele Artikel wie «die Vollzeiter» und produzierte mein eigenes Talk-Format. Doch bald konnte ich auch an meinen freien Tagen nicht mehr abschalten. Die News schlafen nicht – und so hing ich an meinen beiden freien Tagen mit Kleinkind trotzdem ständig am Handy oder am Laptop und war auch für die Redaktion erreichbar.
Was mir meine Motivation letztlich raubte, war ein Mail meines Vorgesetzen. Ich hatte ihm zum ersten Mal überhaupt geschrieben, dass meine Tochter mit vierzig Grad Fieber krank sei und ich erst etwas später kommen könne, weil ich auf meine Schwiegermutter warten müsse. Seine Antwort bestand aus vier Worten: «I am not amused.» Ich glaube, ich hätte besser geschrieben, ich müsste das Auto vorführen, es wäre eher akzeptiert gewesen, als dass mein Kind krank ist. Immer öfter stellte ich mir die Frage: «Wofür machst du das hier eigentlich?»
Ich hatte mir immer geschworen, dass ich das mit der Zeitung nur so lang mache, wie es unserer Tochter dabei gut gehen würde. Dass die Situation auch mich an den Rand der Belastbarkeit bringen würde, hatte ich gar nie in Erwägung gezogen. Die allseitigen Erwartungen nagten an mir, letztlich auch meine eigenen. «So ein herziges Kind gibt man doch nicht ab», sagte die Kinderfrau einmal zu mir – der ich notabene den Lohn zahlte. Ich las, dass Kinder möglichst lang gestillt werden sollten. Dass der Krippenbesuch und der ständige Wechsel der Bezugspersonen schaden könnten. Leise Bemerkungen aus meinem Umfeld. Immer wieder.
Mit den Kosten für die Krippe und der ausserfamiliären Kinderbetreuung, für die wir mit zwei Einkommen voll zahlten, sie von den Steuern aber nicht voll abziehen konnten, und den regulären Steuern auf meinem Einkommen zum Satz meines Mannes, blieb mir Ende Monat von meinem Salär nicht mehr gerade viel übrig. Die Anreize für einen zweiten Verdienst sind in der Schweiz praktisch inexistent, ein zweites Pensum zwischen sechzig und achtzig Prozent wird steuerlich eher bestraft. Belohnt wird nur ein Modell: Die Frau arbeitet maximal ein bis zwei Tage pro Woche, dann kommt der Zweitverdienerabzug voll zum Tragen und die Steuerbelastung sinkt. Das heutige Steuersystem bestraft die Berufstätigkeit von verheirateten Müttern, wenn sie mehr als vierzig Prozent arbeiten. Wer jedoch mehr als «bloss einen Job» machen will, müsste zu mindestens sechzig Prozent erwerbstätig sein. Da Teilzeitarbeit für Männer aber noch immer nicht salonfähig ist, heisst das, dass die Erwerbstätigkeit des Mannes keine Manövriermasse ist. Anders als bei den Frauen.
Die Jahre, in denen wir «durchgehalten» hatten,waren aber dennoch wichtig. Es erlaubte mir, mich in meinen Dossiers zu etablieren und heute als selbständige Moderatorin, Journalistin und Juristin zu arbeiten – und viel wichtiger, nun zum ersten Mal wirklich «gleichzeitig» für die Familie da zu sein. Ich würde sagen, ich konnte dem System ein Schnippchen schlagen, indem ich mich selbstständig machte, obschon ich keine Ahnung hatte, ob das jemals funktionieren würde. Generell fällt auf, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf meistens bei vier Gruppen «funktioniert». Erstens bei jenen, die Unterstützung von Eltern und Schwiegereltern bekommen. Zweitens bei Paaren, bei denen beide sehr gut verdienen und die sich eine Nanny leisten können, sowie drittens bei unverheirateten Müttern, weil bei ihnen die Kinderbetreuung (zu Recht!) stark subventioniert ist, sowie viertens bei Alleinerziehenden – weil es funktionieren muss.
WIR LEBEN IN LINEAREN
STRUKTUREN. FRAUEN
SIND ANDERS, UNSERE
LEBEN SIND ZYKLISCH
Für mittelständische Familien ohne elterlichen Beistand oder gutes Salär scheint mir die Selbstständigkeit fast die beste Option, weil sie sehr flexibel ist. Unser gesamtes Gesellschaftssystem der Mittelschicht ist darauf ausgerichtet, dass die Mütter hauptsächlich zuhause bleiben. Und die Väter das Einkommen stemmen. Das fängt mit dem einseitigen Mutterschaftsurlaub an, geht bei der Steuerpraxis weiter, die das niedrigere Zweiteinkommen über die Massen belastet, und hört letztlich bei der Vorstellung über die perfekte Mutter auf. Zwischendrin lauern noch die Heiratsstrafe, eine AHV, die Mütter über ihren Ehepartner versichert, nicht vollständig abziehbare Krippenkosten oder die Schule, die stetiges Engagement von den Eltern verlangt. Die Liste könnte man noch lang weiterführen. Schliesslich läuft es darauf hinaus: Frauen und Männer sind in der Schweiz gleichberechtigt – so lang, bis sie Kinder haben.
Wir leben in linearen Strukturen, in einer in ihren Wurzeln patriarchalisch geprägten Arbeitswelt: Montag bis Freitag, am Wochenende ist Pause. Jeder Wochentag ist gleich. Frauen sind anders. Unsere Leben sind zyklisch. Da gibt es Tage, an denen wir die Welt erobern können, und andere, an denen wir unsere kranken Kinder pflegen. Und wenn sie gesund sind, dann brauchen wir jemanden, der für sie sorgt, wenn wir nicht da sind. Dieser jemand ist übrigens in der Regel weiblich und schlechter bezahlt als wir selbst. Ich nehme es keiner Mutter übel, die sich den Stress dieser Arbeitswelt nicht antun will, ihre Kinder lieber selber betreut und mittags ein ausgewogenes Essen selbst zubereiten will. Ich habe auch Hochachtung vor jenen Frauen, die nicht in der privilegierten Situation sind, zu wählen.
Aber ich verstehe eben auch alle anderen, die ihre Jobs gern mögen – und finanziell vom Partner unabhängig bleiben wollen. Machen wir uns nichts vor: Den ganzen Tag zuhause bei den Kindern, die Berge von Wäsche und Haushalt, die ständige Zubereitung von Mahlzeiten in Schnellzeit, die Geduld, die Nerven, die gefragt sind – das ist kein leichter Job. Zudem sind wir Frauen in der Arbeitswelt gefragt. Meist gleich gut ausgebildet wie die Männer, könnten wir die Lücke der in Pension gehenden Babyboomer füllen. Nur: Wenn zunehmend die Berufstätigkeit der Frauen eingefordert wird, dann muss auch auf ihre Bedürfnisse und die ihrer Kinder Rücksicht genommen werden. Viel wäre gewonnen, wenn die Schulzeiten mit den Arbeitszeiten abgeglichen würden. Statt fixe Arbeitszeiten kann man mit seinen Angestellten Jahresarbeitszeit vereinbaren, ihnen nach Möglichkeit mehr Flexibilität oder Remote Work einräumen. Überhaupt: Wir müssten die Zeit zwischen dreissig und vierzig, die sogenannte Rush Hour des Lebens, entschleunigen. Karrieren müssen doch nicht mehr so linear verlaufen wie anno dazumal. Und wenn ein Vater einige Jahre Teilzeit arbeiten will, dann sollte das nicht als Affront gegen den Chef, sondern als Chance für beide gesehen werden.
WENN DIE BERUFSTÄTIGKEIT
DER FRAUEN EINGEFORDERT
WIRD, DANN MUSS AUF IHRE
BEDÜRFNISSE UND DIE
IHRER KINDER RÜCKSICHT
GENOMMEN WERDEN
Die Vereinbarkeit in der Schweiz ist letztlich etwas, das vielen Frauen vordergründig gelingen mag. Wie oft aber sie selbst, die Kinder oder die Partnerschaft darunter leiden oder gar daran zerbrechen, ist von aussen nicht sichtbar. Ich sehe nur, dass die weiblichen Wirtschafts- und Politfiguren mit Kindern dünn gesät sind und oftmals ihre Karrieren im Ausland machten. Zu viele von uns ziehen sich während der Kleinkindzeit an den Herd zurück. Doch sind nicht wir es, die an den Urnen die Politik verändern können? Sind nicht wir es, die mit unseren Handlungen die Gesellschaft nach und nach anpassen und für bessere Bedingungen sorgen können? Und bräuchte es nicht mehr von uns in den wichtigen Positionen in der Wirtschaft, damit das geschieht? Es liegt auf der Hand, dass dafür die oben genannten Strukturen geändert werden müssten. Das würde nicht bedeuten, dass jede Frau gleich hundert Prozent arbeiten und die Karriereleiter hochsteigen muss. Aber sie könnte es zumindest, wenn sie es wollte.