
Hausfrau: Ein Roman über die Schweiz der US-Expats
- Interview: Claudia Senn
In «Hausfrau» wirft Jill Alexander Essbaum einen nüchternen Blick auf die Schweiz der US-Expats. Und verarbeitet ihren Schmerz.
Klären wir zuerst die Missverständnisse: «Hausfrau» ist kein Erotikroman, wie dies verschiedene Schweizer Medien glauben machen wollen. Zwar kommen ein paar einschlägige Szenen der eher schlichten Sorte darin vor, doch sie sind mehr Beigemüse als Hauptspeise. Nein, die Lektüre ist aus anderen Gründen lohnenswert: Die amerikanische Autorin Jill Alexander Essbaum gibt in ihrem in Zürich, Dietlikon und Uster angesiedelten Debütroman Einblick in die sonst so hermetisch abgeschlossene Parallelgesellschaft der amerikanischen Expat-Wives.
Die Hauptfigur, die Amerikanerin Anna, lebt in längst erkalteter Ehe mit dem Schweizer CS-Banker Bruno, hat drei wohlgeratene Kinder, ein Haus in der Agglo, viel zu wenig zu tun und eine zu kryptischen Kalendersprüchen neigende Psychoanalytikerin, der sie sich nicht offenbaren mag.
Nach neun Jahren in Dietlikon verzehrt sie sich schon lange nicht mehr nach den USA, doch mit der Schweiz wird sie auch nicht warm: «Die Schweiz ist eine Maschine, die in der Nacht runterfährt. Kein Laden ist offen. Die Menschen schlafen, wann es sich gehört.» Mit kaum jemandem kommt sie ins Gespräch, die Schwiegermutter ist ihr feindlich gesinnt, von den Nachbarn fühlt sie sich beobachtet – die Einsamkeit hat sich wie zäher Hefeteig auf ihren Alltag gelegt.
Doch statt nach Auswegen aus ihrer Depression zu suchen, verharrt Anna beinahe unerträglich konsequent in ihrer Passivität. Einzig die Affären, mit denen sie ihre gut situierte Existenz riskiert, hauchen ihr vorübergehend etwas Leben ein. Und so entwickelt das Buch trotz zahlreicher Klischees und Oberflächlichkeiten einen finsteren Sog, dem man sich kaum entziehen kann. Diese «Hausfrau» ist alles andere als bieder.
Annas Passivität sei eigentlich Lebensangst, sagt Jill Alexander Essbaum über ihre unglückliche Heldin. «Es gibt für Frauen so viele Arten, eingesperrt zu sein.» Anna wäre besser beraten, um Hilfe zu bitten oder in Frauenfreundschaften zu investieren als in Sex. «Doch sie steckt ihren Kopf in den Rachen des Bären, um zu sehen, was der Bär tut. Es ist, als würde sie mit geschlossenen Augen Auto fahren.» Logisch, dass diese Geschichte nur im Fiasko enden kann.
Essbaum weiss, wovon sie spricht, denn auch sie lebte von 2006 bis 2008 in einem Vorort von Zürich, krank vor Heimweh und weit davon entfernt, sich auch nur ansatzweise in die Schweizer Gesellschaft zu integrieren. Ihr Buch steckt voll schillerndem Lokalkolorit: Von der Messer-Trophy bei Coop bis hin zum im Lokalfernsehen auftretenden Hellseher Mike Shiva ist jedes Detail stimmig.
Essbaum ist eine stille, feinfühlig wirkende Frau, die jedes ihrer Worte mit Bedacht wählt. Nichts Eitles oder Schrilles haftet ihr an. Dass die hiesige Presse sie in die Schmuddelecke stellt und mit schlüpfrigen Fragen traktiert, verletzt sie. Doch daran ist auch ihr deutscher Verlag mitschuldig, der ihren Roman mit dem Slogan «Madame Bovary meets Fifty Shades of Grey» promotet und im Klappentext eine Blowjobszene zitiert. Das weckt falsche Erwartungen. Wir treffen die 44-jährige Schriftstellerin am Nachmittag vor ihrem Zürcher Leseauftritt in einem Hotel.
annabelle: Jill Alexander Essbaum, nach dem Lesen Ihres Romans ahnt man, dass Sie in Zürich keine einfache Zeit hatten. Lag es an der Stadt oder der Lebenssituation?
Jill Alexander Essbaum: Vor allem lag es an mir selbst, denn ich hatte mir viel zu wenig überlegt, was ich hier tun würde. Ich kam mit meinem damaligen Mann nach Zürich, der hier eine Ausbildung zum Psychoanalytiker begann. Durch sein Studium hatte er sofort Kontakte, Aufgaben, eine feste Struktur. Mir fehlte all das schmerzlich.
Womit haben Sie Ihre Zeit verbracht?
Langweilig war es mir nicht. Ich ging viel im Wald spazieren, schrieb, kaufte ein. Doch meine Verlorenheit war wie eines dieser spitzen Steinchen im Schuh, die erst nur ein bisschen drücken, dann irgendwann anfangen, wehzutun, bis schliesslich ein unerträglicher Schmerz daraus wird. Als ich nach zwei Jahren in die Staaten zurückkehrte, fühlte ich mich vollkommen allein und entfremdet.
Hatten Sie von Anfang an geplant, nur zwei Jahre hier zu bleiben?
Nein, wir wollten eigentlich für immer hier leben. Doch ich wurde so traurig, dass es einfach nicht mehr ging. Oft fühlte ich mich, als stünde ich ratlos vor einem dieser Wegweiser mit den gelben Wanderwegtafeln: Soll ich hier entlang? Oder lieber da? Statt eine Entscheidung zu treffen, war ich vollkommen paralysiert und unternahm gar nichts, um aus meiner Einsamkeit herauszukommen. Meine Traurigkeit verstärkte sich noch durch die Tatsache, dass es in der Schweiz so unglaublich schön ist. Wenn man aus dem Fenster schaut und die Alpen sieht, die manchmal so verblüffend nah erscheinen, dann fühlt man sich gleich doppelt schlecht. Nach zwei Jahren war meine Ehe am Ende.
In Ihrem Buch schildern Sie die Schweizer als unzugänglich und kühl. War es tatsächlich so schwer für Sie, Leute kennen zu lernen?
Ja, doch das lag auch an mir. Ich würde mich nicht unbedingt als schüchtern bezeichnen, aber ich bin definitiv introvertiert. In Texas ist das kein Problem, denn man kann mit jedem ein Schwätzchen halten, ohne gleich sein Innerstes nach aussen kehren zu müssen. Wenn man einen Laden betritt, plaudert man ganz unbefangen mit den anderen Kunden oder der Kassierin: Wie geht es Ihnen? Haben Sie heute noch etwas Schönes vor? Tolles Kleid, das Sie da tragen! Ihnen mag das profan erscheinen, doch es ist wie eine Art soziales Schmiermittel, das alles etwas leichter macht und einem das Gefühl gibt, mit anderen Menschen verbunden zu sein. Das fehlte mir schrecklich.
Wie reagierten die Schweizer auf diese sehr amerikanische Art von Smalltalk?
Irritiert. Manche schauten mich an wie eine Verrückte, die vergessen hat, ihre Medikamente zu nehmen. Ich glaube nicht, dass die Schweizer generell unfreundlich sind, aber die meisten möchten wohl lieber in Ruhe gelassen werden. Ich habe mich oft fehl am Platz gefühlt. Es gab so vieles, was ich falsch machen konnte, und das wurde mir auch sehr deutlich zu verstehen gegeben.
Zum Beispiel?
Als ich das erste Mal in der Migros einkaufte, drückte ich bei der Waage die falsche Nummer für meine Birnen, weil ich den Unterschied zwischen Williams und Gute Luise nicht kannte. Die Kassierin wurde so wütend, als hätte ich eine schwere Straftat begangen. Dabei war es doch bloss ein Versehen.
Die meisten US-Expats machen nicht einmal den Versuch, Deutsch zu lernen. Und Sie?
Ich habe es durchaus versucht, und ich möchte der Migros-Klubschule ein Kränzchen winden. Eine wundervolle Institution! Leider ist Deutsch aber verdammt schwierig. Eine Sprache bedeutet viel mehr als Worte, sie ist verwoben mit kulturellen und gesellschaftlichen Codes, die man erst nach einer Weile begreift. Diesen Punkt habe ich nie erreicht. Deshalb habe ich mich in gewisser Weise sprachlos gefühlt, mir fehlte meine Stimme.
Was hat Sie in der Schweiz am meisten überrascht?
Mehrmals sah ich bei meinen Spaziergängen jemanden am Waldrand Alphorn spielen. Das glaubt mir in Amerika kein Mensch. Viel zu klischiert! Mein grösstes kulturelles Missverständnis besteht deshalb vielleicht darin, dass ich all die Schweiz-Klischees für übertrieben hielt, bevor ich herkam. Doch die Züge sind tatsächlich fast immer pünktlich, die Schokolade schmeckt grossartig, und manchmal bläst eben auch jemand Alphorn.
Alle Zürich-Details in Ihrem Roman sind akribisch recherchiert. Wie haben Sie das gemacht? Schliesslich sind Sie schon vor sieben Jahren nach Austin zurückgekehrt und seither nicht mehr hier gewesen.
Ich sass beim Schreiben zwar in meinem Arbeitszimmer in Texas, doch virtuell lebte ich in Zürich. Auf Google Earth schaute ich mir die Stadt von oben an, im Hintergrund lief ständig irgendein Schweizer Radiosender, und nebenbei guckte ich im Internet «Einstein», «1 gegen 100» oder «SRF bi de Lüt». Aus der Ferne machte mir Zürich grossen Spass.
Wie fühlt es sich an, nach all diesen Jahren wieder hier zu sein?
Es wühlt mich sehr auf. Als ich am Flughafen Kloten das erste typisch zürcherische «Danke vielmal» hörte, war alles wieder da: die schönen und die traurigen Erinnerungen. Ich habe hier die zwei wichtigsten Jahre meines Lebens verbracht. Dank dieser Zeit – so schwierig sie auch war – habe ich erkannt, wer ich bin. Heute bin ich glücklich, habe einen neuen Ehemann gefunden und ein Buch geschrieben. Mein Roman soll auch ein Liebesbrief an Zürich sein. Ich wollte mich bei der Stadt bedanken für all das Gute, das sie für mich getan hat.
— Jill Alexander Essbaum: Hausfrau. Aus dem Amerikanischen von Eva Bonné, Eichborn-Verlag, Köln 2015, 336 Seiten, ca. 32 Franken
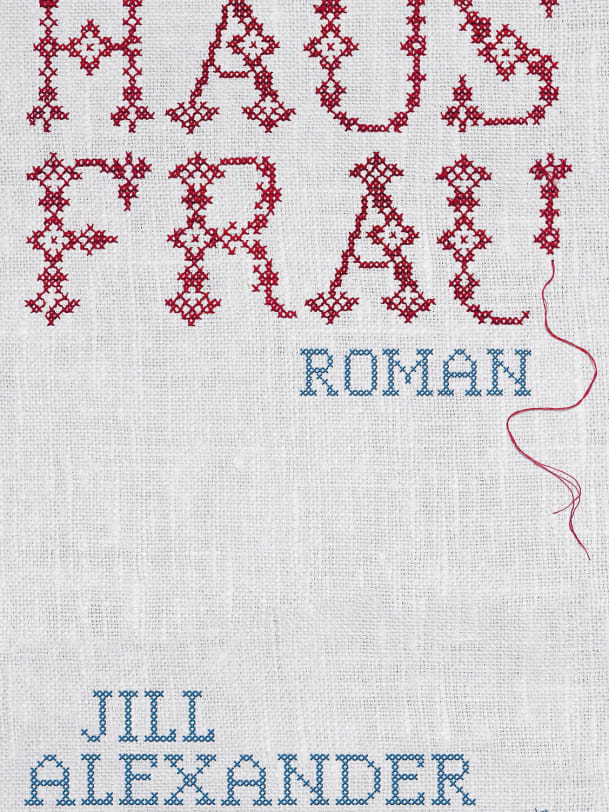
1.
«Mein Roman ist auch ein Liebesbrief an die Schweiz», sagt die «Hausfrau»-Autorin






