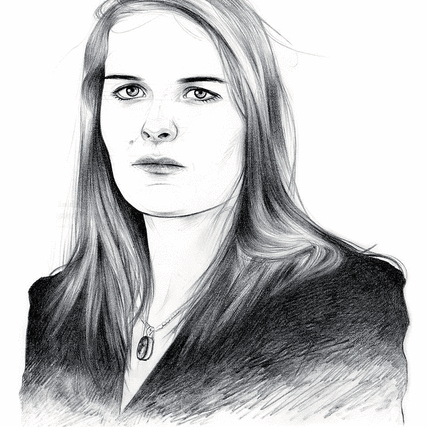Begegnung mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga
- Text: Isabella Fischli; Interview: Barbara Acherman Fotos: Ornella Cacace
Die Frau hinter dem Amt: Simonetta Sommaruga. Wir haben mit der Bundesrätin und ehemaligen Bundespräsidentin gesprochen.
Wäre alles gelaufen, wie es sich die Schweizer Bundesrätin und ehemalige Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga als Mädchen erträumte, wäre sie heute Mutter, Hausfrau, Köchin und passionierte Gärtnerin – genau wie einst auch ihre Mutter. Jetzt empfängt sie stattdessen ausländische Staatschefs, verteidigt sie Bundesratsbeschlüsse im Parlament, versucht sie in jedem ihrer Aufgabengebiete «das Beste für unser Land zu erreichen», wie sie immer wieder verspricht.
Als Vorsteherin des Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) ist sie seit 2010 für die aktuell heikelsten Dossiers zuständig: Zuwanderungs- und Asylpolitik. Mit beidem kann man keine Lorbeeren holen. Besonders auf dem mühsamen Weg zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative bekommt Sommaruga nicht nur keinen Dank zu hören, sondern unablässige Kritik von allen Seiten.
Mitunter auch Schläge einzustecken, das kennt Simonetta Sommaruga, seit sie 1993 beim Konsumentenschutz ihr erstes öffentliches Amt übernahm. Längst geht die heute 55-Jährige gelassen damit um. Manchmal reicht es ihr, den Absender anzuschauen, wie sie schmunzelnd sagt, «dann ist es eigentlich schon erledigt». Alles andere – nein: Alles andere perlt nicht an ihr ab, wie es in Fernsehauftritten manchmal den Anschein macht. «Das wäre falsch. Wenn man etwas nicht mehr an sich herankommen lässt, hat man eine so harte Haut, dass man auch nicht mehr spürt, was einem wichtig ist.»
Und was ist dieser Frau wichtig?
Gerechtigkeit. Und Auflehnung gegen Ungerechtigkeit. «Jenen eine Stimme zu geben, die keine eigene haben oder sie nicht erheben können.»
Justiz- und Polizeidepartement
Es wurde viel darüber geschrieben und gestritten, als die Bundesratskolleginnen und -kollegen der neu ins Amt gewählten SP-Frau Ende 2010 aus parteitaktischen Gründen das ungeliebte Justiz- und Polizeidepartement zuschoben und sie damit ohne Zweifel desavouierten. Sie selbst liess in diplomatischen Worten durchblicken, dass sie vielleicht ein anderes Departement bevorzugt hätte. Doch es dauerte nur einen Moment, bis ihr die Folgerichtigkeit klar wurde und sie sich «riesig» auf ihr Amt freute. «Asyl- und Ausländerpolitik, Kriminalität, gesellschaftliche Fragen wie das Sorgerecht für Kinder oder die Sterbehilfe», zählte sie auf, all das hätte mit der «zentralen Frage nach Recht und Gerechtigkeit» zu tun.
«Wer gehört ins Gefängnis, wie müssten die Strafanstalten aussehen, wie die Wiedereingliederung von Kriminellen nach Ablauf der Strafzeit?»; solche Fragen packte die damalige Ministerin mit der für sie typischen Gründlichkeit an: ging in Gefängnisse und redete dort nicht nur mit Direktoren und Aufsichtspersonal, sondern führte auch 4-Augen-Gespräche mit Gefangenen, etwa einem Mörder, der seit 29 Jahren eingesperrt war. Warum sie das tut? «Um genau zu wissen, womit sie es bei einem Problem zu tun hat», erklärt Vincenzo Mascioli. «Berührungsängste kennt sie wirklich nicht.» Mascioli arbeitet für Simonetta Sommaruga, seit sie das EJPD übernommen hat. Er ist ihr persönlicher Mitarbeiter, Berater, Redenschreiber. Sommaruga fordert ihn. «Für sie ist eine Rede gut», so Mascioli, «wenn sie beides, politische Linie und menschliche Seite, so wiedergibt, dass auch ihre Grossmutter jedes politische Geschäft verstehen könnte, wie sie immer spasshaft sagt.» «Es gibt keinen Grund, mit Fremdwörtern in einer Insidersprache zu reden», sagt Sommaruga. «Dagegen hatte ich immer eine Abneigung. Es hat etwas sehr Ausschliessendes.»
Simonetta Sommaruga stellt hohe Ansprüche an jene, die mit ihr zusammenarbeiten. Das bestätigen auch ihre Politikerkollegen, Parlamentarier aus allen Parteien. Verblüffend an ihrem Urteil ist die weitgehende Übereinstimmung: Sie stehe Rede und Antwort, wo andere ihre Beamten vorschickten; vertrete ihre Sache aus persönlicher Überzeugung; agiere unaufgeregt und hartnäckig, dabei aber nicht beratungsresistent; wolle nicht allen gefallen, suche nicht den Applaus; sei eine Streberin, ganz klar, aber keine Schaumschlägerin; geradlinig, korrekt, keine, die ihre Gegner über den Tisch ziehe.
Vor so viel inner- und überparteilichem Lob für die Art, wie Simonetta Sommaruga politisiert, könnte man die inhaltliche Kritik fast aus den Augen verlieren. Doch da steht ja schon SVP-Präsident Toni Brunner in der Wandelhalle des Bundeshauses und lässt sich nicht lange um einen Kommentar bitten. Nein, er sei wirklich kein Fan von Sommaruga, ruft er so laut, dass ihm die Aufmerksamkeit der Umstehenden gewiss ist. «Sommaruga ist schulmeisterlich, moralisierend, glaubt, uns mit dem Rohrstöckchen wie dummen Schulbuben auf die Finger hauen zu können, ist der Inbegriff der fatalen Angsthasenpolitik dieses unkoordinierten Wohlfühlgremiums mit Namen Bundesrat. Steht in Brüssel wie ein Mäuslein vor der bösen Schlange, statt zu sagen: ‹Herr Juncker, ich schmuse nicht!› Sie verzögert, weicht auf, schwächt ab, trickst, verwässert. Dabei dachte ich ursprünglich, sie hätte das Potenzial, uns in einer restriktiveren Migrationspolitik entgegenzukommen. Ich hielt sie für talentiert und erwartete einiges von ihr. Ich Tubel!» Immerhin gibt selbst Toni Brunner zu, dass die damalige Bundespräsidentin ihre Position hier in der Schweiz «natürlich enorm gut» verkaufe.
Er meint es zwar anders, aber da spricht Brunner indirekt auch etwas an, das mit ihrem Äusseren zu tun hat und wohl mitverantwortlich ist für das Gefühl vieler Menschen, Simonetta Sommaruga sei die reinste Musterschülerin. Es liegt an ihrem Auftritt: immer gut gekleidet, dezent und elegant in ihrer ganzen zierlichen Erscheinung, bescheiden, aber ungezwungen im Umgang mit den Mächtigen der Welt, fünfsprachig, mit vollendeten Manieren. Lob von allen Seiten!
Bemerkenswert ist, dass das Äussere für eine gut aussehende Frau wie sie immer nur eine Nebensache darstellte, wie sie sagt. Mittlerweile habe sie zwar Freude an ihren vielen schönen Kleidern, die ihr unter anderem im Basler Atelier Issue auf den Leib geschneidert werden. Oder am Schmuck von Anna Schmid, der Sommaruga im Geschäft «mit den schiefen Böden» in der Basler Altstadt manchmal fasziniert bei der Arbeit zuschaut. «Zur Mode im Allgemeinen aber hatte ich nie eine starke Beziehung», sagt sie. Auch Nagellack hatte sie noch niemals auf ihren Nägeln, weil das beim Klavierspielen stören würde. Die Schminktechnik schaute sie den Visagistinnen des Schweizer Fernsehens beiläufig ab, wenn sie – damals noch als Konsumentenschützerin – vor «Kassensturz»-Sendungen in der Maske sass. Das Haar schneidet ihr seit zwanzig Jahren der gleiche Coiffeur; inzwischen ist er teilpensioniert, aber sie hofft, dass er sich für ihren Haarschnitt alle sechs Wochen weiterhin Zeit nimmt. Von ihm lernte sie einst auch das Styling für ihre Auftritte in der Öffentlichkeit: «Einfach die Hände mit Wasser benetzen», sagt sie vergnügt, «und mit gespreizten Fingern durchs Haar fahren. Vielleicht noch ein bisschen Gel drauf, und fertig!»
Unnahbar und kühl?
Eine weitere öffentliche Meinung lautet, Sommaruga sei – bedingt durch ihre augenscheinliche Perfektheit – unnahbar, kühl und nicht zu greifen. Zumindest die Angestellten der Fleischfabrik Micarna in der Nähe von Freiburg müssen an diesem 1. Mai 2015 einen anderen Eindruck bekommen haben. Dort ist der Tag der Arbeit kein Feiertag, und die damalige Bundespräsidentin nutzte die Gelegenheit für Gespräche mit Lehrlingen und langjährigen Angestellten des Grossbetriebs.
Wer erwartet hatte, sie würde beim Anblick all der Fleischberge und langen Reihen aufgehängter Schweinshälften schockiert reagieren, hatte sich getäuscht: «Wenn man von Nutztieren redet und Fleisch isst», erklärt sie, «muss man sich mindestens einmal damit konfrontieren, auch wenn einem das ein bisschen zusetzt.»
Die stämmigen Fleischfachmänner, die vor den Augen der Bundespräsidentin wie jeden Tag im vorgegebenen Takt von sieben Sekunden pro Arbeitsschritt ein Fleischstück nach dem anderen zerschnitten und auf Fliessbänder warfen, 1700 Schweine am Tag, 400 Tonnen Rinder pro Woche, liessen sich in ihrer Arbeit nicht weiter stören. Allen schaute die ehemalige Bundespräsidentin neugierig zu, manchen stellte sie Fragen. «Was wir hier tun», konstatierte ein junger Mann mit rotem Gesicht, als Sommaruga mitsamt dem ganzen Begleittross weitergezogen war, «hat sie richtig interessiert!»
Stellt sich die Frage, warum manche Kritiker daran festhalten, Simonetta Sommaruga gebe selten etwas von sich preis. Und jeder ihrer Auftritte sehe so aus, als habe sie ihn vorher minutiös vorbereitet und durchgespielt.
Wahr ist: Als junge Konsumentenschützerin wurde sie einmal von der Gegenseite so «fertiggemacht», wie sie sagt, dass sie später in Tränen ausbrach und sich schwor, nie mehr ins Messer zu laufen. Danach probte sie ähnliche Auftritte mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Lukas Hartmann, manchmal im Voraus durch, um dann mit der nötigen Standfestigkeit in den Kampf zu steigen.
Schlicht erfunden ist hingegen, dass sie nichts über sich verrate oder nicht spontan sein könne. Antworten auf private Fragen lassen sich nicht vermeiden, wenn man noch einiges vorhat mit seiner Karriere. Sogar vor der gefürchteten Homestory schreckte die zunehmend gewiefte Politikerin nicht zurück, wenn sie davon einen gewissen Werbeeffekt für sich selbst oder für das zuletzt erschienene Buch ihres Mannes erwarten konnte. Oder wenigstens einen pädagogischen Sinn darin sah, am Beispiel ihrer privaten Lebensumstände das Modell der Patchworkfamilie zu erklären. Bereitwillig nahm sie Journalisten heim in ihr Zweifamilienhaus in Sichtweite des Bundeshauses am Fuss des Berner Gurten, spazierte barfuss durch ihren grossen Garten, zeigte voller Stolz all die verschiedenen Früchte und Gemüsesorten, die da gedeihen, und schlug sogar vor, sie könnte auch in Gummistiefeln für ein Foto posieren.
Nun ist das nicht mehr so. Als schweizerische Bundespräsidentin des Jahres 2015 empfing Sommaruga Journalisten lieber woanders. Ihr Musikzimmer, wo sie früher zwischen Flügel, Spinett und Geige über bevorzugte Komponisten und Autoren plauderte, bekommt die Öffentlichkeit nicht mehr zu sehen. Für informelle Treffen ist sie aber nach wie vor zu haben: Als das lange zuvor angemeldete Interview endlich über die Bühne gehen kann, schlägt Simonetta Sommaruga noch vor unserer ersten Frage ein zweites Treffen «vielleicht ausserhalb des Büros» vor.
Während die Stimmung beim Interview draussen völlig ungezwungen, darum aber nicht weniger ernsthaft ist, hat die Atmosphäre im Büro der Justizministerin etwas seltsam Irritierendes: als würden bei einem Examen Dozent und Student gleichzeitig geprüft. Da mögen die von ihr selbst gewählte Einrichtung, die Kunst an den Wänden, der prächtige Blumenstrauss einen noch so gediegenen Eindruck machen. Das geschmackvolle Ambiente ändert nichts daran, dass man in der gedämpften Stille dieses Raums eine ungeheure Last spürt. Wer tut sich das freiwillig an, Verantwortung für all die komplexen Probleme zu übernehmen, über die hier Tag um Tag diskutiert und gebrütet wird?
«Ich weiss genau», sagt sie, «was mir guttut, um ein lebendiger, sensibler Mensch zu bleiben: Natur, Musik, Literatur, Bewegung an der frischen Luft, die Pflege von Freundschaften, Zeiten völliger Unproduktivität – all das bringt mir den nötigen Ausgleich.» Nebst gutem Essen: «Mit Essen kann man mich glücklich machen.»
Wir sind inzwischen von ihrem Departement neben dem Bundeshaus zum libanesischen Restaurant Domino beim Bahnhof spaziert. Sie esse auch nicht wenig, ergänzt sie fröhlich, und habe viele Lieblingsspeisen. Einige davon geniesse sie auswärts. Andere bereite ihr Gatte – ein exzellenter Koch – für sie zu.
Das «Domino» liefert seine Speisen manchmal auch ins Bundeshaus für das gemeinsame Mittagessen des Bundesrats nach seiner wöchentlichen Sitzung – wobei die Bundesräte, die sich während der Sitzung stets respektvoll mit Sie ansprechen, beim Essen sofort zum vertraulichen Du wechseln.
Tatsächlich scheint der jetzige Bundesrat – aus Sommarugas Beschreibung zu schliessen – ein taugliches Team zu sein. Sie erklärt es mit einem Vergleich: «Eine gute Bundesratssitzung ist wie gemeinsames Musizieren. Jeder kommt mit seinen Vorstellungen, und wenn das Gesamte nachher besser ist als das Einzelne, ist es wie bei der Kammermusik. Das Resultat hat niemand vorausgesehen. Das ist das Einzigartige an diesem Land. Fünf Parteien in einer Regierung – eine wahnsinnige Erfahrung! Auch wenn manche Entscheidung nicht im ersten Anlauf gefällt wird und noch eine Woche reifen muss.»
Keine dezidiert linke Politik
Die Reifezeit in der Entscheidungsfindung ihrer Kollegin Simonetta ist manchen Parteigenossen allerdings ein Dorn im Auge. Sie werfen ihr vor, mit ihrer linksliberalen Haltung den Bürgerlichen zu stark entgegenzukommen, «viel zu kompromissbereit in ihrem fatalen Drang, Lösungen zu erreichen». CVP-Präsident Christophe Darbellay kann darüber nur lachen. «Mir ist es recht, dass sie – wie auch Bundesrat Berset – nicht eine dezidiert linke Politik verfolgt», sagt er. «Beide passen den Bürgerlichen gut! Berset geht mehr taktisch und strategisch vor. Sommaruga sucht gute Lösungen und einen gangbaren Weg. Bei den meisten andern muss man sich immer fragen, was sie im Hinterkopf haben. Bei ihr nicht: Was sie sagt, darauf kann man sich verlassen.»
Sie selbst erklärt ihren Meinungsbildungsprozess so: «Ich gebe zu, manchmal lasse ich mich echt verunsichern, wenn ich erkenne, dass mein Gegenüber sehr gute Argumente hat. Dann kann es sein, dass etwas davon auch meine Haltung verändert. Es kann aber auch sein, dass ich nach einer Phase der Verunsicherung klarer bin als zuvor und sage: ‹Das stimmt zwar, aber …›»
Gefragt, wie sie sich die annähernd ideale Schweiz vorstellen würde, antwortet sie, es gebe eine sehr weltoffene, urbane Schweiz und eine andere, sehr wertkonservative Schweiz. In den letzten Jahren sei die Kluft zwischen den beiden eher grösser geworden – einerseits durch die Globalisierung, andererseits durch politische Kräfte, welche die Polarisierung bewusst verstärkten. «Daher wünschte ich mir, dass beide Seiten akzeptiert und geschätzt würden im Bewusstsein, dass beide zusammen erst die eigentliche Stärke der Schweiz ausmachen».
Simonetta Sommaruga kennt die ländliche Schweiz aus eigener Erfahrung. In den Sechzigerjahren im aargauischen Sins aufgewachsen, erlebte sie ihr Dorf als «eine katholische, wertkonservative Gemeinschaft, in der – wie in Dörfern üblich – die soziale Kontrolle stark war.»
In ihrem gutbürgerlichen Elternhaus sahen Simonetta und ihre drei Geschwister – trotz der streng katholischen Erziehung – quasi einen weltläufigen Gegenentwurf zur dörflichen Enge: Der Vater, Lonza-Werkleiter und viel unterwegs, war im Tessin aufgewachsen. Mit den Gutenachtgeschichten, die er ihnen abends vorlas, lernten die Kinder Italienisch «als Kindersprache».
Aber der Name Sommaruga, die italienischen Vornamen der Kinder hatten auch eine weniger angenehme Seite: Damals wurden die italienischen Gastarbeiter, die man als billige Arbeitskräfte ins Land geholt hatte, in der Deutschschweiz als «Tschingge» verspottet, und Sommaruga, die sich mit ihren Tessiner Wurzeln mitgemeint fühlte, solidarisierte sich voller Widerwillen gegen den «ungerechten Schimpfnamen». Viel schlimmer wurde es aber, als Nationalrat James Schwarzenbach mit seiner Überfremdungsinitiative eine drastische Reduktion des Ausländeranteils forderte. Hätte das Stimmvolk die Initiative 1970 nicht mit 54 zu 46 Prozent abgelehnt, wären 300 000 Menschen des Landes verwiesen worden.
Wenn es so etwas wie ihr politisches Erwachen gegeben hat, muss es zu diesem Zeitpunkt gewesen sein.
Den entscheidenden Anstoss, «die Stimme zu erheben» und in die Politik zu gehen, bekam sie allerdings erst Mitte der Achtzigerjahre. Inzwischen war sie ausgebildete Pianistin. Den Traum einer Solistinnenkarriere hatte sie aufgegeben – «dazu war ich einfach nicht gut genug!». Stattdessen unterrichtete sie Klavier am Konservatorium und am Lehrerseminar in Freiburg. Daneben übernahm sie die Nachtwache im Haus für geschlagene Frauen. Und plötzlich war sie in der Lage, ihre angeborene Schüchternheit zu überwinden: «Was mit diesen Frauen und ihren Kindern passierte, empörte mich so sehr», erinnert sie sich, «dass ich fand, das müsse die Gesellschaft wissen.» Sie begann, Infoabende zu organisieren und sich für die Frauen «hinzustellen und ihnen eine Stimme zu geben».
Der Rest ist Geschichte: 1986 trat sie in die SP ein, 1993 übernahm sie die Geschäftsführung – und später das Präsidium – der Stiftung für Konsumentenschutz, 1997 wurde sie Könizer Gemeinderätin, 1999 Nationalrätin, 2003 Ständerätin, 2010 Bundesrätin, 2015 Bundespräsidentin. Plötzlich lief alles wie am Schnürchen.
Eine Karriere wie aus dem Bilderbuch, geradeaus in Richtung Erfolg. «Aber das stimmt doch nicht!», ruft Simonetta Sommaruga. «Wenn ich meine Biografie anschaue … Mehr Kurven kann man kaum machen! Ich bin Musikerin, habe 17 Jahre Klavier unterrichtet und aufgehört. Habe ein Studium angefangen, englische und spanische Literatur, und abgebrochen. Kam zum Konsumentenschutz – auch nicht unbedingt nachvollziehbar. Wenn man jetzt zurückschaut, scheint alles so folgerichtig. Doch so habe ich es nicht erlebt. Ich bin auch immer wieder gescheitert. Für eine linke Politikerin ist das eine tägliche Erfahrung. Das ist ein Ringen, da kann man nicht einfach absahnen.»
Als Beispiel einer politischen Abfuhr nennt sie die Genschutzinitiative von 1998 mit fast 70 Prozent Nein-Stimmen. «Diese Niederlage war so schlimm, dass ich eine Zeit lang fand: Ich mag mich nicht mehr engagieren.» Sie rappelte sich wieder auf und ging ihren politischen Weg weiter. Doch was wurde aus ihrem Jungmädchentraum, später einmal Mutter zu werden? Das Thema ist nicht einfach, auch heute noch nicht.
Als sie 1984 dank eines aargauischen Stipendiums für ein Jahr nach Rom gehen konnte, um sich am Konservatorium weiterzubilden, traf sie im Istituto Svizzero den Schweizer Schriftsteller Lukas Hartmann. Er hielt sich für die Arbeit an einem Buch dort auf, war 40 Jahre alt und Vater von drei Kindern aus zwei früheren Beziehungen. Mit ihren 24 Jahren wirkte Simonetta dagegen fast wie ein Mädchen.
Später wurden sie ein Paar, doch erst 1996 entschlossen sie sich zur Heirat und lebten von da an im gemeinsamen Berner Haus. Da war Sommaruga 36 und bereit, ihren Wunsch nach eigenen Kindern aufzugeben, weil es für ihren Mann «zu kompliziert gewesen wäre, noch mehr Kinder zu haben», wie sie sagt. Diesem Verzicht war «eine lange Trauerarbeit» vorausgegangen, erzählte sie in einem Interview einmal. «Mein Lebenskonzept war nie die Karriere, sondern die Familie.» Sie möge Kinder, liebe es, ein Baby auf dem Arm zu wiegen, Kindergesang würde sie zu Tränen rühren.
Heute ist sie dankbar für das gute Verhältnis mit den drei inzwischen erwachsenen Kindern ihres Mannes und ihrem Stief-Grosskind.
Und es wäre nicht Simonetta Sommaruga, würde sie bei diesem Thema den Fokus nicht auch auf gesellschaftspolitische Aspekte lenken: Dass sich viele Väter für die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder nicht ebenso verantwortlich fühlten wie die Mütter, erklärt sie, sei problematisch. Gewalt und Jugendkriminalität hätten auch mit der vaterlosen Gesellschaft zu tun. Deshalb setze sie sich für Elternurlaub und Teilzeitarbeit für Väter ein …
Unvermittelt hält sie inne, schaut auf ein kleines Schild auf dem Tisch. Ab 18 Uhr sind die Plätze reserviert, da macht die Wirtin keine Ausnahme. «Auch das liebe ich an der Schweiz», bemerkt Simonetta Sommaruga, während sie mit einem Zeichen die Rechnung bestellt. «Hier wird man als Bundespräsidentin behandelt wie alle anderen.»
Im Interview
ANNABELLE: Simonetta Sommaruga, warum schneidet die Schweiz in Sachen Gleichberechtigung von Mann und Frau so schlecht ab im europäischen Vergleich?
SIMONETTA SOMMARUGA: Die Schweiz ist in Bezug auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Entwicklungsland. Die gute Nachricht ist, wir können uns noch entwickeln (lacht). Unser schlechtes Abschneiden hat verschiedene Gründe, ein wichtiger Faktor ist der Wohlstand. Man kann in der Schweiz immer noch oft mit einem einzigen Lohn eine Familie ernähren.
In Norwegen beispielsweise sind die Löhne ebenfalls hoch. Trotzdem ist dort die Gleichberechtigung viel fortgeschrittener.
In den nordischen Ländern dominiert die Vorstellung, dass der Staat für die Chancengleichheit Verantwortung übernehmen muss. In der Schweiz hingegen gibt es eine politische Mehrheit, die findet, die Frauen sollen selber schauen, dass sie zu ihren Rechten kommen.
Dennoch haben Sie zwei staatliche Instrumente lanciert: die Einführung einer Frauenquote von 30 Prozent in den obersten Firmengremien sowie obligatorische Lohnkontrollen. Wie haben Sie den Bundesrat überzeugt?
Die Lohngleichheit steht seit bald 35 Jahren in der Verfassung, doch noch heute werden Frauen für gleichwertige Arbeit schlechter bezahlt als Männer. Man hat 35 Jahre lang vergeblich gehofft, die Unternehmen würden das freiwillig ändern, Jetzt ist genug. Das Gleiche gilt für Verwaltungsräte und Unternehmensleitungen: Der Frauenanteil ist seit Jahren gering, obwohl es in der Schweiz Hunderte von Frauen gibt, die qualifiziert und bereit wären, Führungspositionen zu übernehmen. Und obwohl man aus verschiedenen Untersuchungen weiss, dass gemischte Teams besser arbeiten.
Es überrascht trotzdem, dass Sie den Bundesrat überzeugen konnten.
Wir diskutieren hart im Bundesratszimmer – und wir diskutieren vertraulich … Was ich allgemein dazu sagen kann, ist: Diskussionen um Gleichstellungsthemen sind häufig sehr aufwendig und anstrengend. Ich habe schon erlebt, wie sich an einer Sitzung über Gleichstellung die Männer zurücklehnten und die Frauen sich stritten. Wenn das geschieht, geht gar nichts. Erst wenn sich auch die Männer für die Chancengleichheit verantwortlich fühlen, wird sich etwas verändern.
Kritik kommt auch von Frauen. Sie sagen, Quote und Lohnpolizei würden die Frauen wieder zurückdrängen in die Rolle des schwachen Geschlechts.
Niemand will eine Lohnpolizei, auch der Bundesrat nicht. Er will lediglich, dass die Firmen ihre Löhne analysieren, dass sie diese Analyse durch Dritte prüfen lassen und dass sie darüber informieren. Ist das ein starker staatlicher Eingriff? Nein, ganz sicher nicht.
Sie haben in der Geschäftsleitung Ihrer drei grössten Verwaltungseinheiten neun Männer und fünf Frauen neu eingestellt. War es schwer, geeignete Frauen zu finden?
In den höchsten Chargen ist die Auswahl an Frauen tendenziell kleiner. Ich will aber in der Shortlist der Bewerbungen immer mindestens eine Frau. So konnte ich zum Beispiel im Bundesamt für Polizei, wo es viele klassische Männerberufe gibt, eine Direktorin anstellen.
In Ihrem obersten Verwaltungskader liegt der Frauenanteil bei 24 Prozent. Können Sie dennoch eine Quote vertreten?
Selbstverständlich. Denn wenn ich den Frauenanteil bei meinen Neubesetzungen in den Geschäftsleitungen der drei grossen Bundesämter anschaue, liegen wir bei 36 Prozent.
Was müssten denn die Frauen selber tun für mehr Gleichberechtigung?
Ich empfehle jungen Frauen jeweils, sie sollen einen Mann heiraten, der gut kochen kann (lacht). Und ich möchte ihnen raten, die Gleichberechtigung mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit zu leben, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch bei der Rollenverteilung in der Beziehung. Am einfachsten geht das übrigens zusammen mit starken Männern, denn starke Männer haben keine Angst vor starken Frauen.
Reden wir über Gleichberechtigung in der Asylpolitik. Zwei Drittel der Menschen, die übers Mittelmeer flüchten, sind Männer. Früher konnten Flüchtlinge direkt bei einer Schweizer Botschaft im Ausland Asyl beantragen, was gerade für alte Menschen, Frauen und Kinder wichtig war. Warum sind Sie gegen die Wiedereinführung des Botschaftsasyls?
Ich habe nicht gesagt, dass ich dagegen bin. Aber das müsste ein gesamteuropäisches Projekt sein.
Weil in Europa alle aufeinander warten, geschieht leider sehr wenig.
Ich sehe das anders. Wir leisten mit verschiedenen Projekten in den Krisenregionen direkte Hilfe vor Ort, etwa in Syrien, Jordanien, Tunesien oder im Libanon. Und mit den Visaerleichterungen im vorletzten Jahr konnten 4500 Syrerinnen und Syrer direkt in die Schweiz einreisen. Ausserdem hat der Bundesrat beschlossen, dass wir noch einmal bis zu 3000 besonders schutzbedürftige Menschen aufnehmen. Das werden mehrheitlich Frauen, Kinder, ältere und kranke Leute sein.
Die Schweiz war auch schon grosszügiger. Während des Kosovo-Konflikts nahmen wir 53 000 Flüchtlinge auf.
Wir waren aber auch schon weniger grosszügig. Nach den 90er-Jahren bis 2012 nahmen wir gar keine Kontingentsflüchtlinge mehr, wir führten diese Möglichkeit dann für die Flüchtlinge aus Syrien wieder ein. Ich bin in diesem Amt nicht nur verantwortlich für die grossen Gesten, sondern für jede einzelne Person: traumatisierte Kinder, Kranke, Alleinerziehende, Jugendliche in Ausbildung. Diese Menschen brauchen eine Unterkunft, eine enge Betreuung, vielleicht ein Spitalbett. Ich denke, das hat mich gelehrt, demütig zu sein, oder man könnte auch sagen: bescheiden. Zu meiner Aufgabe gehört es auch, Menschen zurückzuschicken, wenn sie unseren Schutz nicht brauchen. Das ist wichtig für eine glaubwürdige Asylpolitik, die von der Bevölkerung mitgetragen wird.
Vor 15 Jahren waren Sie noch anderer Meinung. Damals sagten Sie: «Ich will die Scheingerechtigkeit hinterfragen, die wir im Asylwesen geschaffen haben. Wie wollen wir etwa Wirtschaftsflüchtlinge von politischen Asylbewerbern unterscheiden?»
Damals kannte ich die genauen Abläufe unserer Asylpolitik noch zu wenig. Heute weiss ich, dass die Migrationsbehörden sehr sorgfältig prüfen, ob Asylsuchende in der Heimat an Leib und Leben bedroht sind oder nicht. Auch haben wir in den vergangenen Jahren Verbesserungen erzielt. Heute können wir den Asylsuchenden unsere Entscheide schneller mitteilen. Wenn sie schutzbedürftig sind und bleiben dürfen, können sie sich schneller integrieren. Und wenn sie nicht schutzbedürftig sind und freiwillig zurückreisen, erhalten sie Geld für den Aufbau einer neuen Existenz.
Sie sagten einst, Sie wehren sich «gegen die Einteilung in Ausländer, die uns wirtschaftlich nützen, und solche, die uns kommerziell nichts bringen». Sehen Sie das noch heute so? Ja, ganz entschieden. Ein traumatisierter Flüchtling ist nicht weniger wert als ein sogenannter Topshot, das ist letztlich eine Frage der Menschlichkeit und der menschlichen Würde. Klar ist aber auch: Alle Staaten versuchen, qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen. Und wer reich genug ist, kommt ohnehin zu einer Aufenthaltsbewilligung. Das ist eine Realität. Auch in der Schweiz.

1.

2.

3.
Sie hat ihr Deutsch- und Russischstudium «erfolgreich abgebrochen», um Mutter von sechs Kindern und begeisterte Hausfrau zu werden, und arbeitete genauso engagiert als freie Journalistin und Redaktorin, unter anderem für «Das Magazin». 2002 veröffentlichte Isabella Fischli eine Bestseller-Biografie über Bundesrätin Ruth Dreifuss, für uns hat sie Bundesrätin Simonetta Sommaruga porträtiert.