
Autorin Anja Glover: "Der Rassismus hat mich krank gemacht"
Die Soziologin und Antirassismus-Expertin Anja Glover hat mit "Was ich dir nicht sage" ihr erstes Buch veröffentlicht. Sie beschreibt darin, wie Schweizer:innen sich weigern, das Thema Rassismus ernstzunehmen – und welche gesundheitlichen Folgen Diskriminierung haben kann.
- Von: Marie Hettich
- Bild: Mirjam Kluka
Inhaltshinweis: Diskriminierung, Trauma
annabelle: Anja Glover, Sie sind in den vergangenen fünf Jahren in der Schweiz zur Antirassismus-Expertin geworden, gaben Workshops an Schulen, Events, in Firmen. In Ihrem Buch "Was ich dir nicht sage" blicken Sie auch auf diese Zeit zurück. Was haben Sie während Ihrer Arbeit über die Schweiz und ihr Verhältnis zu Rassismus gelernt?
Anja Glover: Anfangs hat mich überrascht, wie viele Menschen in der Schweiz davon überzeugt sind, dass Rassismus ein rechtsextremes Phänomen sei, mit dem niemand etwas zu tun hat – ausser Nazis. Auch in meinem privaten Umfeld bin ich ein paar Mal auf diese weitverbreitete Ansicht gestossen. Glücklicherweise hat "Black Lives Matter" das Bewusstsein für Rassismus etwas geschärft. Nichtsdestotrotz erstaunt mich immer wieder, wie gross der Wille ist, Rassismus nicht als Problem anzuerkennen.
Wie verträgt sich die Schweizer Mentalität mit Ihrer antirassistischen Arbeit?
Schlecht. Die Schweizer Kultur macht es dem Antirassismus sehr schwer.
Inwiefern?
Man will nicht in den Spiegel schauen, ungemütliche Themen wie Rassismus oder auch Geld werden unter den Tisch gekehrt. Deshalb konnte die Schweiz auch so lange die eigene Kolonialgeschichte verleugnen. Wenn man Missstände benennt, gilt man schnell als aktivistisch – und damit als aggressiv. Ich glaube, das ist auch mitunter ein Grund, warum viele Verlage mein Buch nicht publizieren wollten. Und ich mich schlussendlich dazu gezwungen sah, es mithilfe eines Crowdfundings selber herauszugeben: Ich benenne darin Dinge, die in der Schweiz sehr schwierig zu benennen sind. Wie die Reaktionen auf das Buch ausfallen werden, macht mir manchmal etwas Sorge. Es kann gut sein, dass sich meine Auftragslage dadurch verschlechtern wird. Aber das Risiko ist es mir wert.
Wie kommen Sie zu dieser Annahme, dass Ihr Buch aus diesem Grund bei vielen Verlagen abgelehnt wurde?
Einige – nicht alle – Rückmeldungen gingen in diese Richtung. Zudem braucht man sich nur die Bücher ansehen, die auf dem deutschsprachigen Markt zum Thema Rassismus publiziert wurden: Sie sind meistens sehr erklärend und für ein Publikum gemacht, das nicht direkt betroffen ist.
"In meinen Antirassismus-Workshops fühlen sich viele angegriffen, bevor es überhaupt losgeht"
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Ihnen Ihre Arbeit vor allem mit denjenigen Menschen schwerfällt, die davon überzeugt sind, alles schon längst richtig zu machen: den sogenannten "Gutmenschen".
Mit Menschen, die absichtlich einer rassistischen Ideologie folgen, zu diskutieren, ist zwar krass, aber zumindest weiss man, woran man ist. Bei den "Gutmenschen" hingegen wird alles so kaschiert und verdeckt, dass es gar nicht erst zur Diskussion kommt. Sie machen ihren Selbstwert so stark von dem Gedanken abhängig, dass sie "gute Menschen" sind, dass alles, was nicht diesem Bild entspricht, abgestritten werden muss. Es passt einfach überhaupt nicht in ihr Selbstbild, dass auch sie rassistische Denkmuster haben – wie wir alle.
Was ist für Sie der grösste Unterschied zwischen der Arbeit mit Kindern und mit Erwachsenen?
Auch Primarschulkinder und Jugendliche tragen schon rassistische Denkmuster in sich – aber sie sind sehr neugierig. Mich stimmen die Workshops an Schulen immer hoffnungsvoll, weil alle ganz motiviert vier Stunden lang mitmachen. Der Schulkontext hilft da auch: Es liegt es in der Natur der Sache, dass man dort ist, um dazuzulernen. Erwachsene kommen wiederum sehr oft mit der Überzeugung zu den Workshops, sie wüssten schon alles.
Wie äussert sich das?
Vor allem bei Pflichtveranstaltungen – wenn der Workshop von den Arbeitgeber:innen vorgeschrieben wird – treffe ich in der Gruppe oft auf verschränkte Arme oder geschlossene Augen. Das sind für mich immer die schwierigsten Workshops. Dass ich als Schwarze Frau etwas über Rassismus erzählen will, löst oft schon eine grosse Abwehrreaktion aus. Viele fühlen sich angegriffen, bevor es überhaupt losgeht. Mir ist aber wichtig zu betonen: Das sind meist keine absichtlich bösartigen Menschen; es sind einfach Leute, die eine riesige Angst davor haben, ihr eigenes Tun zu hinterfragen.
Werden vor Beginn eines solchen Antirassismus-Workshops von den Auftraggeber:innen konkrete Bedingungen an Sie gestellt?
Kommuniziert wird sehr oft, dass es nicht politisch werden soll – was natürlich eine merkwürdige Forderung bei einem hochpolitischen Thema ist. Häufig werden konkrete Themen genannt, die ich nicht erwähnen darf.
Zum Beispiel?
Rund um die Weihnachts- und Fasnachtszeit werde ich oft darum gebeten, "Blackfacing" nicht zu erwähnen, also wenn weisse Menschen ihr Gesicht schwarz anmalen, um sich zu verkleiden. Die Veranstalter:innen erwarten auch, dass mein Tonfall stets freundlich bleibt und es die Möglichkeit gibt, auch "schwierige Fragen" zu stellen. Die Personen, die mich einladen, haben sich meist schon mit Rassismus auseinandergesetzt, und sie mussten intern oft Kämpfe führen, damit es überhaupt zu einem Workshop kommt. Für sie ist es sehr wichtig, dass alles gut über die Bühne geht und ich eben nicht dem Klischee einer aggressiven Aktivistin entspreche.
Das scheint Ihnen gut zu gelingen. In Ihrem Buch schreiben Sie, Ihre Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen ruhig zu bleiben und nicht wütend zu werden, sei Ihre stärkste Waffe.
Dafür werde ich immer gelobt, wenn ich als Antirassismus-Expertin eingeladen werde: Dass ich so ruhig und einfühlsam über schwierige Themen reden kann. Dass ich nicht wütend werde. Dass ich alle Workshop-Teilnehmenden dort abholen kann, wo sie stehen. Und ja: Das ist eine Gabe. Und eine Waffe, weil ich mit der Fähigkeit, so ruhig bleiben zu können, selbst wenn es in mir manchmal tobt, Zutritt zu Orten wie beispielsweise grossen Firmen bekomme, wo viele von uns BIPoCs (Anm. der Red.: Black, Indigenous, and other People of Color) keinen Zugang haben. Aber diese Rolle der stets Verständnisvollen wurde für mich zunehmend zum Problem.
Warum?
Weil ich es verlernt – oder vielleicht gar nie gelernt – habe, auf Verletzungen auch emotional zu reagieren. Denn mir war immer klar: Als "Angry Black Woman" hat man in unserer Gesellschaft direkt verloren. Deshalb wäge ich immer alles, was ich sage, pervers genau ab.
"Wenn ich meine Arbeit mache, verlasse ich gewissermassen meinen Körper, um nicht verwundbar zu sein"
Sie schreiben, dass in unserer weissen Gesellschaft für Schwarze Frauen eigentlich nur zwei Rollen vorgesehen seien: diejenige der "Angry Black Woman" – und die der "Strong Black Woman", wie sie in der Popkultur beispielsweise von Michelle Obama oder Beyoncé verkörpert wird.
Der Gegenentwurf zur "Angry Black Woman" ist die "Strong Black Woman" – und dieser Superheldin werden ihre Gefühle gleich komplett entzogen. Sie muss stets die Fassung bewahren, darf nicht jammern. Und sie muss brillieren. Ich wuchs wie viele Arbeiter-, migrantische und BIPoC-Kinder mit dem Narrativ auf: "Work harder, be smarter". Also mit der Aufforderung, immer ein bisschen besser als alle anderen sein zu müssen, damit man überhaupt eine Chance hat, wahrgenommen zu werden. Das ist auf Dauer nicht gesund.
Vor zwei Jahren erhielten Sie die Diagnose: doppelter Bandscheibenvorfall, eine angerissene Bandscheibe, Ansätze von Arthrose und Burnout-Gefahr. Und dann schlug keine der Therapien an.
Ich habe vieles versucht – nichts hat geholfen. Irgendwann wurde mir klar, dass meine Schmerzen jedes Mal, wenn ein Workshop oder Event anstand, stärker wurden. Ich dachte mir: Ich bin jung, lebe gesund, hatte keinen Unfall, nichts – da muss es einen Zusammenhang geben! Wenn ich meine Arbeit mache, verlasse ich gewissermassen meinen Körper, um nicht verwundbar zu sein. Erst wenn ich heimgehe, mich am Abend ins Bett lege, wenn ich in die Ferien fahre, kommt mein Körper langsam zurück.
Wie ging es weiter?
Mir war lange nicht bewusst, wie stark mich meine Arbeit belastet – bis ich konstant Schmerzen hatte, kaum mehr schlafen konnte. Und mich dann selbst auf die Suche nach der Ursache machte, viele Bücher las, online recherchierte. Heute bin davon überzeugt: Diese Schmerzen haben mit einem Racial Trauma zu tun – und mit meiner Arbeit, bei der ich mich immer wieder aufs Neue rassistischen Anfeindungen aussetze, mich konstant erklären, rechtfertigen muss. Der Rassismus hat mich krank gemacht.
Ein Racial Trauma – was ist das genau?
Der Psychologie-Professor Kenneth V. Hardy – Autor des Buchs "Healing the Hidden Wounds of Racial Trauma" – beschreibt Racial Trauma als ein "Nebenprodukt einer anhaltenden Hyperexposition gegenüber rassistischer Unterdrückung, die eine alles verzehrende, lähmende und schwächende Bedingung darstellt". Rassismus kann schwere gesundheitliche Folgen haben – nur spricht darüber niemand. Auffallend viele Schwarze Aktivist:innen wie Audre Lorde, James Baldwin oder Chadwick Boseman sind sehr früh an Krebs gestorben. Die Autopsie von Dr. Martin Luther King zeigte, dass er das Herz eines 60-Jährigen hatte, obwohl er gerade einmal 39 Jahre alt war.
Wie können Sie ganz sicher sein, dass Ihre Rückenschmerzen mit einem Racial Trauma zu tun haben?
Muss ich das denn? Tatsache ist, dass mit der vertieften Auseinandersetzung und dem Schreiben des Buches meine Rückenschmerzen verschwunden sind. Letzten Endes war das die einzige "Therapie", die mir geholfen hat. Dafür brauche ich keine ärztliche Diagnose.
Sie schreiben in dem Zusammenhang, dass so gut wie kein:e Psychotherapeut:in in der Schweiz das Thema Rassismus auf dem Schirm hat. Warum wäre das Ihrer Ansicht nach wichtig?
Anstatt auf sensibilisierte Therapeut:innen zu treffen, stossen Betroffene in der Therapie oft auf einen Ort, an dem sie erneut Rassismus erfahren. Zum Beispiel, indem sie erklären müssen, dass diese Diskriminierungsform in der Schweiz überhaupt existiert. Gerade jüngere Leute erzählen mir in meinen Coachings oft, dass ihre Leiden in der Psychotherapie stets auf Familienprobleme oder sonstige individuelle Themen zurückgeführt wurden, anstatt dass jemand mal strukturelle Probleme wie Rassismus mitdachte. Die Psychotherapeutin Lucía Muriel, die auf Trauma, Gewalt und Migration spezialisiert ist, sagt dazu: "Rassismus wird von der Gesellschaft getragen, obwohl wir wissen, dass er krank macht."
"Ich glaube fest daran, dass ein Heilungsprozess möglich ist"
Ihr Buch ist unterteilt in die Kapitel Verletzung, Identität und Heilung. Wie kann man von etwas heilen, das wohl zeitlebens existieren wird?
Heilung ist immer ein Prozess – und im Gegensatz zu den vielen Generationen vor mir habe ich heute die Möglichkeit, einen solchen Prozess zu durchlaufen. Ich glaube fest daran, dass ein Heilungsprozess möglich ist, wenn wir uns nicht nur auf das ewige Reagieren auf ein unterdrückendes System konzentrieren – sondern den Blick auch auf uns selbst richten. Fragen stellen, Dinge aufarbeiten, uns Selbstfürsorge schenken und Kontakt zur Community suchen. Auch für die kommenden Generationen ist das ganz wichtig.
Gerade ist Ihr Buch erschienen – und nun sind Sie schwanger. Ein Zufall?
Nein, ich denke nicht. Ich schaffe Platz für ein neues Kapitel. Mir war es wichtig, ganz viel aufzuwühlen und auszusprechen, bevor mein Körper der Wohnort eines neuen Menschen wird. Ich will so wenig wie möglich von diesen Schmerzen an mein Kind weitergeben. Natürlich bin ich von meinem Racial Trauma nicht komplett geheilt, aber es ist schon ganz viel passiert.
Wie blicken Sie auf die kommenden Jahre?
Ich denke, ich werde mich erst mal aus der Öffentlichkeit etwas zurückziehen. Ich weiss eh nicht, was durch das Buch passieren wird, aber für mich ist das gerade auch okay. Jetzt noch ein paar Lesungen – und dann: Babypause.
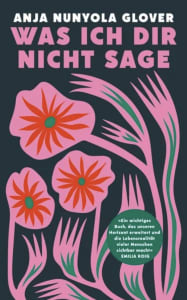
Anja Nunyola Glover (31) ist Soziologin, Autorin und Antirassismus-Trainerin. Im Buch "Was ich dir nicht sage" setzt sie sich intensiv mit ihrer persönlichen Geschichte und den Strukturen von Rassismus auseinander. Die Buchvernissage findet am 25. Januar 2025 im Karl*a die Grosse in Zürich statt. Weitere Termine für Lesungen findet ihr hier.
Ihr seid von Rassismus betroffen und sucht Hilfe? Network Racism ist ein Beratungsnetz für Rassismusopfer. Hier findet ihr verschiedene Beratungsstellen in der Schweiz; hier könnt ihr rassistische Vorfälle melden.











Es wäre einmal Interessant einen Artikel über den asiatischen Rassismus zu lesen. Die Einstellung der Japaner, Koreaner, Thailänder gegenüber Europäern, Afrikanern und anderen Asiaten.
Ich finde die gestellte Fragen sind schon mal auch ein Beweis. “Wie können Sie ganz sicher sein, dass Ihre Rückenschmerzen mit einem Racial Trauma zu tun haben? “
Schweizer Kolonialgeschichte?
Vorurteile und Rassismus sind eineiige Zwillinge. Vorurteile sind uns angeboren sodass wir in unbewusster Schnelligkeit entscheiden können ” Freund oder Feind”. Das war tausende von Jahren ein Überlebensmechanismus. ABER heute sind wir (auch) durch die kulturelle Entwicklung einen Schritt weiter. Sollte man meinen…, denn wir haben ( hätten) die Möglichkeit Dinge zu hinterfragen. Rassismus ist ja die Folge von angewandten Vorurteilen Deutsche sind so und so, Italiener sind…. Schwarze sind… etc.
Aber vom Hirnbesitzer zum Hirnnutzer braucht es das Nachdenken, das Hinterfagen, das Differenzieren. Und das ist überall gleich. Ich glaube nicht, dass wir Schweizerinnen rassistischer als andere sind. Aber eben auch nicht weniger rassistisch. Und ich bin überzeugt, und dass es überall so ist.
Als Deutscher ist man gefühlt per se Rassist. Beruhigend zu sehen, dass auch in der Schweitz nicht alles Gold ist was glänzt. Ansonsten bin ich bei Mona. Als Mann einer Asiatischen Frau bekommt man da nochmal ne ganz neue Perspektive.
Die Kommentare zeigen, wie sich Leute bei diesem Thema sofort angegriffen fühlen und in eine Abwehrhaltung gehen. Das macht es unteranderem so schwer für Betroffene darüber zu reden. Auch wenn Schweizer*innen nicht rassistischer sind als andere, so müssen wir nun mal das Thema hier aufarbeiten, weil wir hier leben. Empfehlung: Buch / Podcast “exit racism”.
Und zur Schweizer Kolonialgeschichte… auch wenn die Schweiz offiziell keine Kolonien hatte, so war sie dick am Sklavenhandel beteiligt und profitiert bis heute von Schoggi und Gold und anderen Gütern, welche sie sich in dieser Zeit unter den Nagel gerissen haben. Empfehlung: Ausstellung im Landesmuseum Zürich “Kolonial” bis Ende Januar.
Danke Anja für deine wertvolle Arbeit!!
Liebe Marie Hettich
Danke für das Interview, das dem Buch eine wichtige Plattform bietet.
Die Frage “Wie können Sie ganz sicher sein, dass Ihre Rückenschmerzen mit einem Racial Trauma zu tun haben?” war nicht angemessen und genau ein Beispiel, wie die Autorin auf sowas ruhig und freundlich antworten können muss.
Hätten Sie z.B. Mara Rikli oder Agota Lavoyer diese Frage auch gestellt, wenn sie gesagt hätten, dass ihre Arbeit als Aktivistin für Inklusion / gegen sexuelle Gewalt negative gesundheitliche Auswirkungen auf sie hat?
Wieso müssen Betroffene von Rassismus beweisen, dass a) Rassismus existiert b) dass rassistische Erlebnisse tatsächlich welche sind und c) dass dies emotional und körperlich belastend ist?
Auch wenn es gut gemeint ist und Sie der Autorin wahrscheinlich wohlgesinnt sind – diese Frage war nicht in Ordnung und nicht angebracht.