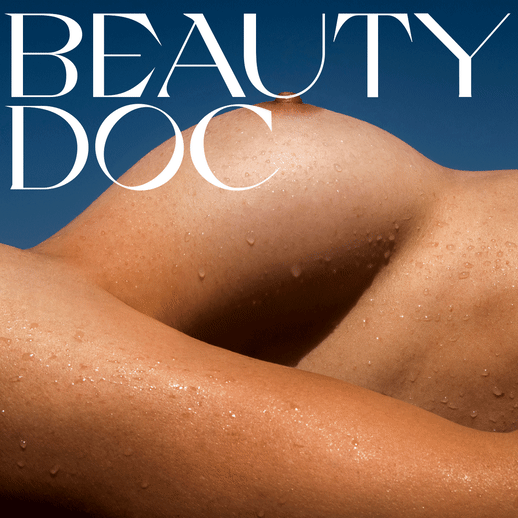
Kolumne «Beauty Doc»: Warum wir entspannter mit Schönheits-OPs umgehen sollten
- Text: Natasha Forster
- Bild: Stocksy; Collage: annabelle
Wir sprechen lieber über die Schönheitsoperationen der anderen, als dass wir jemals eigene Behandlungen zugeben würden. Unser Beauty Doc plädiert für die Enttabuisierung von Schönheitseingriffen.
Über plastische Chirurgie und ästhetische Medizin redet man nicht. Ich muss präzisieren: Man redet nicht über die eigenen plastisch-ästhetischen Behandlungen. Über die von anderen aber umso lieber – und dies selten in einem positiven Ton. Diese Omertà gibt es nicht überall.
Während hierzulande die bezahlte Fremdeinwirkung auf die körperliche Erscheinung totgeschwiegen wird, ist in anderen Ländern und Kulturen das Optimieren des eigenen Körpers so normal und unpeinlich wie Haarekämmen. In Südkorea bekommen coole Kids zur Matura eine Lidoperation geschenkt, und im Iran versucht man, mit Nasengips-Attrappen eine stattgefundene Operation vorzutäuschen, wenn der Kontostand keine echte OP erlaubt.
Dass man nicht mit jeder beiläufigen Bekanntschaft über die eigene Schamlippenverkleinerung reden will, ist verständlich. Aber es ist doch erstaunlich, dass jeder Akt der Verschönerung bloss nicht als solcher wahrgenommen werden soll. Warum diese Geheimnistuerei?
Ich höre schon das Raunen: Ich tu das ja nur für mich, die anderen geht das nichts an. Blödsinn! Wie die Corona-Krise gezeigt hat, mutieren wir in der Isolation zu mit fettigen Haaren im Bademantel auf verkrümelten Laptops töggelnden Amöben, die sich mitnichten so sehr um ihre Schönheit «für sich selber» scheren. Wir sind soziale Wesen und leben von der Interaktion mit anderen.
«Ich will, dass es natürlich aussieht» ist der Standardsatz in meinen Beratungsgesprächen, wenn ich mich nach dem Ziel der Behandlung erkundige. Die zynische Reaktion darauf wäre: Dann brauchen Sie mich nicht, denn natürlich sehen Sie jetzt aus. Notabene wäre dies nicht selten sogar die medizinisch sinnvolle Antwort.
«Ist etwas weniger schön, nur weil es nicht immer so war?»
Der Clou aber ist, dass «natürlich» nicht gleich «unmerklich» ist – und dass sich mit der passenden Terminologie vieles herunterspielen lässt. Die akzeptierte Formulierung für die meistverlangte Brustgrösse, also das Vanille-Glace unter den Brüsten, ist zum Beispiel das sogenannte «Kleine C» – was auch immer genau das ist. Wir BH-kaufenden Frauen wissen nämlich aus eigener Erfahrung, dass das Körbchen keine genormte SI-Einheit ist.
Interessanterweise ist statistisch gesehen einer der häufigsten Gründe für Unzufriedenheit nach einer Brustvergrösserung, dass sie immer noch zu klein sind. Offensichtlich ist aber das «Kleine C» oder die «Nicht so wie Nicole Kidman»-Botox-Behandlung hierzulande ein vertretbarer Euphemismus für «ich will ein Cup D» und «machen Sie bitte alle meine Falten weg».
Das Image der plastischen Chirurgie ist unnuanciert. Es ist immer ein Fake, billig und immer falsch. Es geht beim Aesthetic Enhancement Shaming aber nicht primär darum, dass man nicht gut aussehen soll. Sondern darum, nicht zuzugeben, dass man nachgeholfen hat. Aber ist etwas weniger schön, nur weil es nicht immer so war?
Versteht mich nicht falsch: Dies ist kein Plädoyer für die ästhetische Medizin, denn ihr verschönernder Effekt ist leider oft ziemlich unbefriedigend. Es ist ein Plädoyer für die Enttabuisierung der Eitelkeit. Diese und der Versuch, aus dem Naturgegebenen das Beste herauszuholen, sind nämlich so alt wie die Menschheit.
Natasha Forster (43) ist Fachärztin für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Sie führt die Klinik Swisspark in Zürich und ist Belegs- und Konsiliarärztin an diversen öffentlichen Spitälern.







